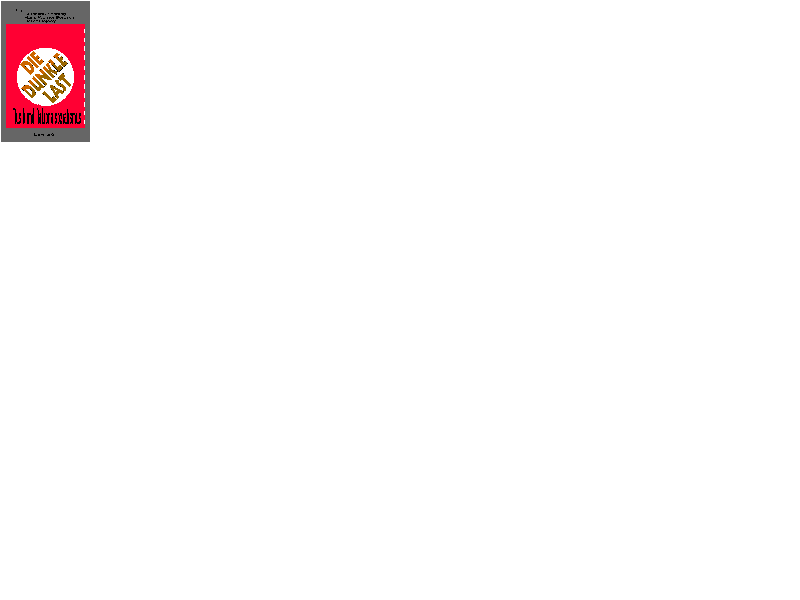
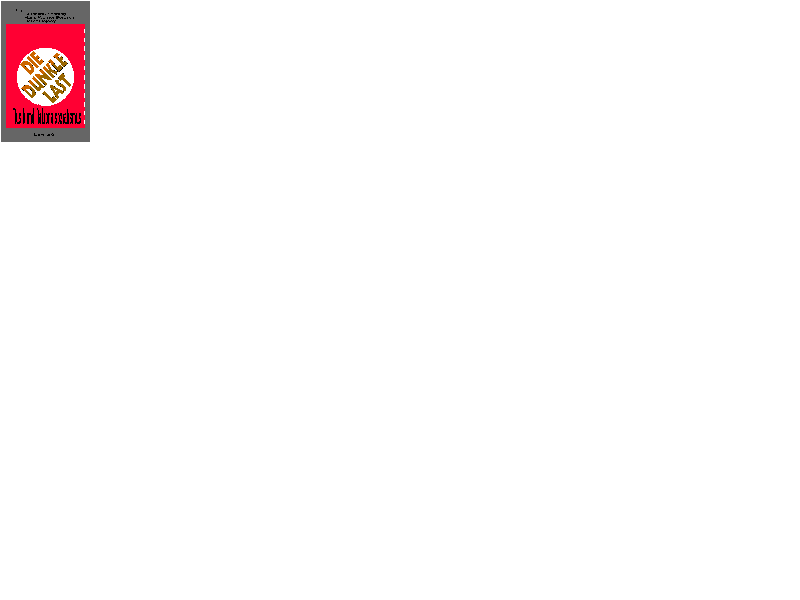 |
Brunhilde Sonntag, Hans-Werner Boresch, Detlef Gojowy
(Hg):
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
Qualifizierte Spezialisten bieten zu diesem hochinteressanten und immer noch brisanten Fragenkomplex in detailreichen Beiträgen ein sehr facettenreiches Bild. Weitgefächert sind dabei die gewählten Methoden und Darstellungsweisen. Individuellen Biographien wird ebenso nachgespürt wie werkanalytischen Befunden einzelner Kompositionen, und spartenübergreifende Fragestellungen befassen sich auch mit Tanz und Film, mit Körperkultur, mit musikphilosophischen, -soziologischen und -ästhetischen Fragestellungen.
Stimmen zum Buch:
Rezension von K. V. in: "N-Zeitung" von 11. 02. 2000
Der vorliegende Band enthält die Referate zu den beiden Symposien
"Die dunkle Last. Musik im Nationalsozialismus (Bergische Universität-Gesamthochschule
Wuppertal)" und "Stunde Null? Musik in Deutschland 1945 (Katholische
Akademie Franz Hitze Haus, Münster)". Die beiden Symposien bieten
einen Rückblick auf die schwerste Zeit in Deutschland im 20. Jahrhundert.
Gleichzeitig bieten die Referate einen Einblick in die Kulturgeschichte
der Nazizeit, die Verbindung von Musikern und Musik in den Zwängen
einer militanten Diktatur und die vereinnahmte Kulturpolitik. Das Buch
mit seinen Forschungsergebnissen ist ein wesentlicher Beitrag zur musikwissenschaftlichen
Erforschung der NS-Zeit. Die Künstler und Wissenschaftler standen
jeweils im Zwiespalt der nationalsozialistischen Idelogie, in der Verweigerung
durch "innere Emigration" bis hin zu Verfolgung und Tod. Die Tatsachen
wurden im Referat von Peter Petersen über Kurt Huber deutlich. Er
war seit 1942 der geistige Mittelpunkt einer nationalsozialtischen stuentischen
Bewegung innerhalb der Universität München. Nach seiner Entdeckung
wurde er mit den Geschwistern Scholl und einigen anderen Studenten
vom "Volksgerichtshof" zum Tode verurteilt. Petersen hatte vor allem
den Abschiedsbrief an seine Frau interpretiert, der Beitrag verdeutlicht
die gesamte Unmenschlichkeit des Regimes.
Jost Hermand befasst sich eindringlich mit der Kulturszene im "Dritten
Reich". So erwähnt er den führenden Germanisten der Weimarer
Republik, den Berliner Ordinarus Julius Petersen, der in Hitler den ersehnten
und geweißsagten Führer sah. Auch Martin Heidegger erklärte
am 3. November 1933 vor Freiburger Studenten, dass der Führer selbst
und allein die heutige und künftige Wirklichkeit sei.
Die Herausgeber:
Brunhilde Sonntag, geb. 1936. Studium der Pädagogik in Jugenheim / Darmstadt; Kompositionsstudium in Wien (Gottfried von Einem); Studium der Musikwissenschaft in Marburg. 1977 Promotion (Untersuchungen zur Collagetechnik in der Musik des 20. Jahrhunderts, Regensburg 1977). Nach Lehrtätigkeit in Gießen und Münster Professorin für Angewandte Musiktheorie in Duisburg (1981-1992), seit 1992 an der Bergischen Universität - GH Wuppertal. Mitherausgeberin u.a. des Buches Nach Frankreich zogen zwei Grenadier. Zeitgeschehen im Spiegel von Musik (Münster 1992). Kompositionstätigkeit (Lieder, Orchester-, Kammer- und Klaviermusik etc.).
Hans-Werner Boresch, geb. 1956. Studium der Musikwissenschaft und der Germanistik in Bochum (1981 Staatsexamen); 1990 Promotion in Bochum (Besetzung und Instrumentation. Studien zur kompositorischen Praxis Johann Sebastian Bachs, Kassel etc. 1993). Seit 1986 als Musikwissenschaftler im Fach Musikpädagogik an der Bergischen Universität - GH Wuppertal tätig, von 1997 an als Akademischer Oberrat.
Detlef Gojowy, geb. 1934 bei Dresden. Musikwissenschaftler, Slawist, Germanist. Dr. phil. 1966 in Göttingen (Neue sowjetische Musik der 20er Jahre, Neufassung: Laaber 1980). Bis 1997 Redakteur für Neue Musik am WDR. Mitglied des J. G. Herder-Forschungsrates, der Accademia Filarmonica di Bologna, des Arbeitskreises Kultur des XX. Jahrhunderts der Universität Zagreb, Autor im Freien Deutschen Autorenverband. - Weitere Buchveröffentlichungen: Rowohlt-Monographie Dimitri Schostakowitsch (Reinbek b. Hamburg 1983); Alexander Glasunow, sein Leben in Bildern und Dokumenten (München 1986), Arthur Lourié und der russische Futurismus (Laaber 1993), [Hrsg.] Augustyn Bloch. Ein Komponistenleben in Polen (Köln 1999). Veröffentlichungen, Gastvorlesungen etc. zur Avantgarde in Ost- und Ostmitteleuropa; literarische Arbeiten.
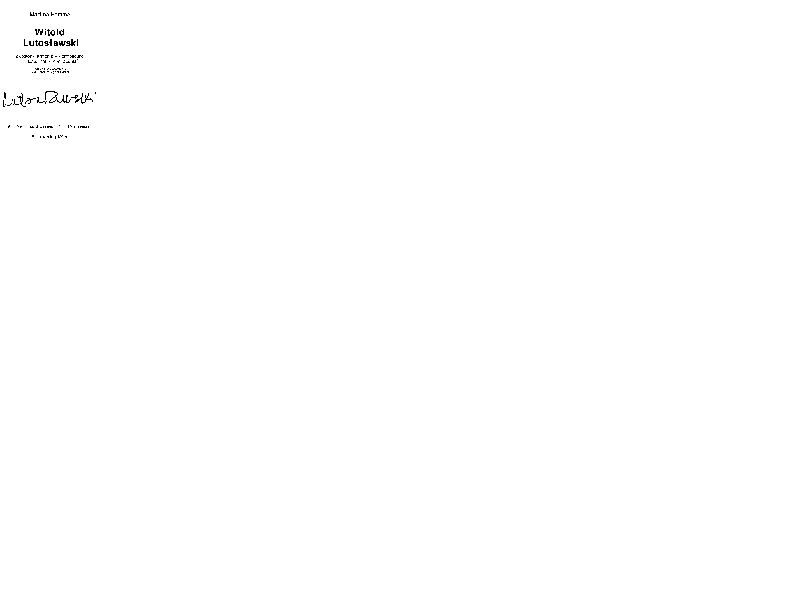 |
Martina
Homma
|
|||
|---|---|---|---|---|
Diese mit der höchsten Auszeichnung benotete Dissertation ist die bisher umfassendste Auseinandersetzung mit der Musik eines der größten Komponisten unserer Zeit. Der Generation von Olivier Messiaen, Dimitri Schostakowitsch und John Cage zugehörig, wurde Lutoslawski durch politische Umstände in Polen fast 20 Jahre hindurch in seiner Entwicklung behindert.
Auch nach seinem Durchbruch Ende der 50er Jahre zu einer individuellen zeitgenössischen Musiksprache wurden von einer vielfach auf die serielle Avantgarde konzentrierten Musikgeschichtsschreibung sowohl die Neuartigkeit seiner zwölftönigen Harmonik als auch die Konsequenz seiner individuellen Formbildung, ebenso wie die detailliert strukturierte Vielgestaltigkeit seines "aleatorischen Kontrapunkts" stark unterschätzt. Allein 1997 jedoch widmen sich mehrere mehrtägige internationale Kongresse der Musik Lutoslawskis, die American Musicological Society räumt ihm bei ihrer jährlichen Hauptarbeitstagung eine eigene session ein, und in London ist ein umfangreicher Band der Oxford University Press in Vorbereitung.
Erste Lutoslawski-Studien der Autorin Martina Homma reichen etwas 15 Jahre zurück. Der sonst bei Mitteilungen über seine Musik sehr zurückhaltende Komponist hat mit der Autorin intensive Gespräche geführt, hat in seinem Warschauer Haus sämtliche unveröffentlichten Texte sowie Kompositionsskizzen zu sämtlichen Werken zur Verfügung gestellt und auch darüberhinaus aus erster Hand manche Details seines kompositorischen Denkens erläutert. Diese vom Komponisten selbst noch vor seinem Tod offengelegten Aspekte, das eingehende analytische Studium sämtlicher Partituren in ständiger Wechselbeziehung zueinander sowie eine als RAR ("rekursiv-analytische Rasterbildung") bezeichnete Methode des analytischen Zugangs versprechen einen Einblick in kompositorische Fragestellungen, der für weit mehr steht als nur für einen einzelnen Komponisten in unserer Zeit.
Das Buch beschreibt Lutoslawskis Weg zu seiner individuellen Klangsprache und die Rezeption seines Schaffens, diskutiert Beziehungen zu Komponisten unseres Jahrhunderts wie Bartók, Debussy, Ravel, Prokofjew, Cage, Ligeti, Stockhausen, Xenakis sowie zu Komponisten seines Landes (Penderecki, Górecki, Serocki, Regamey, Panufnik). Anschließend widmen sich drei jeweils 120-240 Seiten umfassende Kapitel der Kompositionstechnik, darunter Fragen zur Formbildung - einem bei nicht-traditionellen Formen bisher nur selten untersuchten Phänomen. Der "aleatorische Kontrapunkt" wird mit seinen (nach bestimmten Charakteristika gegliederten) Organisationsverfahren und Klangwirkungen untersucht und auf seine Entwicklung innerhalb des Oeuvres befragt. Auch ein oft übersehender Aspekt wird hier erstmals in analytischer Ausführlichkeit beschrieben: Lutoslawskis individueller Beitrag zur zwölftönigen Ordnung - sein eigenwilliger und dabei sehr konsequenter Zugang zur Komposition mit Zwölftonreihen ebenso wie die spezifischen Zwölftonakkorde (Zwölfton-Positionsklänge), auf denen ganze Kompositionen der 60er Jahre fußen. Etwa 200 ausführlich kommentierte Notenbeispiele, dazu Graphiken und Tabellen sowie Reproduktionen einiger Skizzenblätter illustrieren die Ausführungen. Werkverzeichnis, Literaturverzeichnis, Personen- und Werkregister bilden den Abschluß.
Stimmen zum Buch:
Rezension von Michael Zywietz in: "Die Musikforschung" 1999, Nr. 1, S.142-143
Es ist nicht die Aufgabe einer Rezension, etwas zum Lobe des in der Publikation behandelten Gegenstandes beizutragen, zumal dann, wenn das Werk selbst das überzeugendste Plädoyer für die Musik Witold Lutoslawskis darstellt. Das mit spürbarem Engagement verfaßte Werk - die Autorin konnte direkt mit dem Komponisten zusammenarbeiten - nimmt durch klare Gliederung des Aufbaus und die Höhe des sprachlichen und gedanklichen Niveaus für sich ein. Insbesondere die Überlegungen zur Methode, die systemtheoretischen Vorstellungen verpflichtet sind, und das Bewußtsein für die Unzulänglichkeit einer Stilbeschreibung anhand herkömmlicher Parameter bei der Musik Lutoslawskis wie neuer Musik überhaupt überzeugen sehr.
Gerade die Verdienste Lutoslawskis im Hinblick auf eigenständige formale Lösungen auf dem Gebiet der Symphonik lassen das Bedürfnis nach der weiteren Entwicklung adäquater Kriterien für die Beschreibung und Analyse von Formkategorien in zeitgenössischer Musik um so dringender erscheinen. Hier sind von der Autorin zahlreiche einleuchtende Lösungen gefunden worden, die Fehlleitungen in der Rezeption korrigieren.
Akzeptiert man die Prämisse, daß die Musik Lutoslawskis in der Musikgeschichte des zu Ende gehenden 20. Jahrhunderts einen ähnlichen Rang einnimmt wie die Messiaens, so muß die vergleichsweise geringe Zahl der Einzeluntersuchungen zu seinem OEuvre Ansporn für zukünftige Bemühungen unseres Faches darstellen. Die Kölner Dissertation der Autorin markiert in jedem Falle einen Meilenstein in der Auseinandersetzung mit dem Komponisten Lutoslawski. (Rezension von Michael Zywietz in: "Die Musikforschung", Januar-März 1999, Heft Nr. 1, S.142-143)
Rezension von Detlef Gojowy in: "Das Orchester" 1997, Nr. 6, S. 61
Auch wenn es nicht um den polnischen Klassiker der Avantgarde ginge, verdienten die im Eingangskapitel dargelegten Vorsätze und Überlegungen der Autorin Beachtung, dem "Personalstil" eines Komponisten auf die Spur zu kommen: sich einerseits nicht auf seine Eigenauskünfte völlig zu verlassen, andererseits aber auch nicht auf die eingefahrenen Methoden der Analyse einschließlich der bekannten Lehren der Zwölftontechnik. Denn "dabei steht die Musikwissenschaft ganz am Anfang und tut sich schwer, sich für die Existenz vergleichbarer Formmodelle in der zeitgenössischen Musik zu interessieren" (S.20).
So versucht die Autorin, eine Art cartesisches Koordinatennetz über das Werk des Komponisten zu werfen, um jene spezifischen und gleichbleibenden Merkmale seines Stils zu ergründen, die diesen zugleich von dem anderer Komponisten zuverlässig und beständig unterscheiden. In dieses Verfahren werden nicht nur die publizierten Werke, sondern auch die Skizzen zu ihnen einbezogen, die ihr zu Lebzeiten des Komponisten bei einem mehrjährigen Aufenthalt in Polen zugänglich waren.
Bei diesem "fundamentalistischen" Verfahren kommen nicht allein und so sehr Formschemata in den Blick als vielmehr Formungskräfte wie Akzeleration, Divergenz und Konvergenz; die "Hierarchie der Tonqualität (c-cis)" kann zurücktreten gegenüber der der "Tonposition (C-c1)", was den Ansatzpunkt zur vielzitierten polnischen "Sonoristik" liefert. Wenn Boguslaw Schäffer als frühester Theoretiker dieser Avantgarde 1958 befand, Lutoslawskis Musik belege die Arbeit an einem neuen logischen Harmoniesystem, dann aber 1983 resignierte, es sei nicht leicht, dazu einen Zugang zu finden ohne Kenntnis der Chiffre, denn wie bei Debussy gebe es kein System zu entdecke, obwohl alles klar organisiert sei, so versucht sich Martina Homma doch an dem scheinbar Unmöglichen und befindet sogar, alle Werke Lutoslawskis ließen sich auf ein bestimmtes Formmodell beziehen.
Dies allerdings unter Aufgabe herkömmlicher Kategorien - allein bei der Analyse von Zwölftonstrukturen herrschten "Mißverständnisse, die bis heute einer angemessenen wissenschaftlichen und musiktheoretischen Rezeption dieses Phänomens" entgegenstünden. Andererseits mache die Zwölftonakkordik Lutoslawskis ein grundlegendes Element seines Personalstils gegenüber der überkommenen tonalen Ordnung aus.
Im Kapitel "Lutoslawski und die Musik seiner Zeit" erfahren wir Wichtiges und Entscheidendes zur Musiklandschaft Polens und ihrer Geschichte, das nicht allgemein bekannt ist. Nach Szymanowski waren es Fauré, Strawinsky, Ravel, Roussel und Debussy, die auf sein Weltbild bestimmenden Einfluß ausübten, und Bartók zunächst mehr als die zeitgleiche westliche Avantgarde. Ein unvergleichliches Kapitel Musikgeschichte, d.h. ihre totale Unterdrückung, verursachte der Krieg, und in Lutoslawskis Familie befanden sich Opfer Hitlerschen wie Stalinschen Terrors. Über Lutoslawskis Werk hinaus bietet diese Kölner Dissertation für die Erforschung der Neuen Musik beispielgebende Aspekte. (Rezension von Detlef Gojowy in: "Das Orchester" 1997, Nr. 6, S. 61)
Rezension von Stefan Drees in: MusikTexte" 1997 Heft 72, S. 66
Um es vorweg zu nehmen: Bei Martina Hommas siebenhundertfünfzig Seiten starker Publikation handelt es sich ohne Frage um ein äußerst wichtiges Buch. Denn wer sich ernsthaft mit dem Komponieren des 1994 verstorbenen polnischen Komponisten Witold Lutoslawski beschäftigen will, kommt um die hier ausgebreitete Fülle von Fakten und Details zur Kompositionstechnik nicht herum. Grundlage der Ausführungen ist die in der Einleitung formulierte These, daß Lutoslawskis Musik seit Ende der fünfziger Jahre die Züge eines ausgeprägten und homogenen Personalstils aufweist. Der Terminus "Personalstil" bedeutet für die Autorin ein "mittels 'rekursiv-analytischer Rasterbildung' aufgefundener, untereinander vernetzter Komplex werkanalytisch beschreibbarer Struktureigenschaften einer gemäß rekursiv-analytischer Kriterien homogenen Werkgruppe"; als solcher bestimmt er "gleichsam generativ die Eigenschaften eines zu entstehenden Werks ..., wie dann dessen Eigenschaften wiederum ihn bestimmen und gleichsam neu entstehen lassen" (Seite 8/9).
Mit dem hier verwendeten Begriff der "rekursiv-analytischen Rasterbildung" faßt Martina Homma ihre Bemühung um ein methodisches Konzept zusammen, in dem die Analyse zum sich selbst regulierenden System wird, in ihm wirken die gewonnenen Einzelerkenntnisse wieder auf die analytischen Fragestellungen selbst zurück und erweitern oder korrigieren diese zugunsten neuer Perspektiven. Obgleich die Autorin zunächst jede einzelne Partitur als isoliertes Ergebnis kompositorischer Arbeit betrachtet, dessen Eigenschaften möglichst ohne Anwendung vorgegebener oder anderweitig erprobter Analysemethoden dechiffriert werden sollten, ergibt sich durch die Interaktion von Ergebnissen und Fragestellungen sowie durch zusätzliche Einbeziehung von Kommentaren des Komponisten ein fein ausgearbeitetes analytisches Raster, das einen differenzierten Zugang zum Gesamtwerk Lutoslawskis in seinen verschiedenen Ausprägungen und damit auch zu den konkreten Kennzeichen des konstatierten Personalstils ermöglicht.
Hommas Ansatz unterstellt aber auch dem Personalstil selbst die Eigenschaften eines sich selbst regulierenden Systems, in dem die Kennzeichen eines Werks - die als Lösung einer jeweils spezifischen kompositorischen Fragestellung zu verstehen sind - wiederum auf die Prämissen des Komponierens zurückwirken. Daß solche stilistischen Kriterien allerdings nicht voraussetzungslos entstehen, sondern aus der Wechselwirkung mit unterschiedlichsten äußeren Faktoren aus dem Umfeld hervorgehen, belegt die Autorin durch vielfältige historische Fakten, die Lutoslawskis Komponieren zunächst von außen geprägt und mitgeformt haben. In diesem Zusammenhang deckt sie zahlreiche Vorurteile und Fehleinschätzungen in den Rezeptionsmustern von Lutoslawskis Musik auf. Schließlich macht sie auf den Umstand aufmerksam, daß von den sechziger Jahren an Verbindungslinien zum Schaffen anderer Zeitgenossen nur schwer zu ziehen sind. Demnach rechtfertigt insbesondere die von dieser Zeit an isolierte Position des Komponisten Lutoslawski die Verwendung des Begriffs "Personalstil".
Die zur Diskussion stehende individuelle Kompositionstechnik basiert auf einer Wechselwirkung dreier Bereiche, die sich in ihren unterschiedlichen Ausprägungen gegenseitig beeinflussen: Es sind dies erstens die Tonordnung mit ihrer spezifischen Zwölftönigkeit des Tonmaterials sowie den damit verbundenen melodischen und harmonischen Prinzipien, zweitens der "Aleatorische Kontrapunkt" mit seiner Gestaltung rhythmisch flexibler Fakturfelder im metrumfreien Ensemble-Rubato und drittens die Formbildung, die sich im Herauskristallisieren von Formprinzipien und nicht-traditionellen Formtypen in der Abfolge a-tonaler und a-thematischer Klangfelder äußert.
Entsprechend dieser Unterscheidung gliedern sich Hommas Untersuchungen in drei umfangreiche, voneinander weitgehend unabhängige Teile. Anhand vielfältiger und tiefgehender Analysen beleuchtet sie den Stellenweit der drei Bereiche "aleatorischer Kontrapunkt" und Tonordnung für Lutoslawskis Komponieren und gelangt auf diese Weise zu gut fundierten Aussagen zu den Details der Kompositionstechnik. Die Untersuchungen sind ausführlich durch Notenbeispiele, Graphiken und Tabellen dokumentiert. Äußerst problematisch ist allerdings der enzyklopädische Anspruch der Autorin. Er führt zu einer häufig nahezu undurchschaubaren Aufzählung von Merkmalen und Einzelinformationen, die der Stringenz der intendierten Gesamtdarstellung sichtlich schadet. Martina Homma versucht, die verschiedenen Ausprägungen der jeweiligen kompositorischen Prozeduren zu systematisieren und die Kompositionen Lutoslwskis gewissermaßen "lexikalisch" zu ordnen. Dabei gliedert sie die kompositorischen Methoden häufig überaus umständlich in Untergruppen, wodurch die Lektüre manchmal zu einem recht mühsamen Unterfangen wird. Verwirrend wird dieses Verfahren zudem durch den Umstand, daß die erläuterten kompositorischen Techniken meist in Wechselwirkung mit anderen Faktoren auftauchen und sich daher mehreren der drei großen Untersuchungsbereiche zuordnen lassen. Eine unschätzbare Hilfe sind hier die für jeden Teil des Buchs erstellten umfangreichen Register zur Auffindung aller besprochenen Kompositionen, die den Umgang mit dem Text wesentlich erleichtern.
Leider verstellt sich Martina Homma durch die Fülle des ausgebreiteten Materials eine klare Gesamtdarstellung des eingangs definierten Personalstils Witold Lutoslawskis. In seiner Gesamtheit bleibt das Buch daher eine an vielen Stellen unübersichtliche Quelle von scharfsinnig beobachteten und systematisierten analytischen Details zur Kompositionstechnik des polnischen Komponisten, bei der das darstellende Element zu oft zugunsten einer reinen Präsentation und Aufzählung von Fakten in den Hintergrund tritt. So läßt sich die Publikation ohne Zweifel in erster Linie als hervorragende Informationsquelle nutzen, da sich aufgrund der Register unterschiedliche Aspekte eines Werks aus den verschiedenen Teilen des Texts heraussuchen lassen. Bei alldem verliert die Autorin leider auch manchmal die kritische Distanz zu ihrem Gegenstand: Mit keinem Wort werden Lutoslawskis Ansatz und die sich daraus ergebenden ästhetischen Konsequenzen einer kritischen Betrachtung unterzogen oder die Frage nach jener Redundanz der Musik gestellt, die als Folge der angewandten Kompositionstechniken beim Hören mancher Kompositionen zutage tritt. Denkt man jedoch Hommas Modell weiter, dann lassen gerade diese Punkte sich auf die rückbezüglichen Kräfte innerhalb des Personalstils zurückführen, sind also unmittelbare Auswirkung eines um sich selbst kreisenden kompositorischen Denkens, das prinzipiell keine Einflüsse von außerhalb mehr zuläßt. (Rezension von Stefan Drees in: MusikTexte" 1997 Heft 72, S. 66)
Martina Homma begann ihre Hochschulausbildung
bereits parallel zum Schulbesuch (nach ersten Preisen bei "Jugend musiziert")
und studierte Klavier und Cello an der Folkwang-Hochschule. Fortsetzung
des Studiums in Köln - wiederum parallel an Musikhochschule (Klavier,
Schulmusik, Tonsatz) und Universität (Musikwissenschaft, Germanistik,
Philosophie, Slavistik). Studienbegleitende Tätigkeit als Kirchenmusikerin
sowie als Lehrerin an einer Musikschule, Studienabschlüsse 1984, 1985,
1986 jeweils "sehr gut". Aufsätze, Rezensionen, Rundfunksendungen
und Beiträge für Fachlexika zur Musik des 19. und 20. Jahrhunderts.
Dissertation "opus eximium" über Witold Lutoslawski. Lehrerfahrung
an Musikhochschule (Musiktheorie, Kontrapunkt, Partiturkunde, Formenlehre)
und Universität Köln sowie als Gastprofessorin an der Universität
Siegen (Musikwissenschaft). Gastvorträge und Symposia im In- und Ausland.
1996 Wahl in den Vorstand der Kölner Gesellschaft für Neue Musik.
Ehrenamtliche Tätigkeit in mehreren musikalischen Gremien.
| Leseprobe | Mehr über das Buch |
|---|
 |
Maciej Golab
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
Frederic Chopin, einer der wichtigsten Komponisten der Romantik, Pionier einer weit in die Zukunft weisenden Sensibilität für Harmonik und Klangfarbe, wurde von der deutschsprachigen Musikwissenschaft weniger intensiv erforscht als manche seiner Zeitgenossen - als Schumann beispielsweise, der Chopins Genie als einer der ersten erkannte.
Ein gewichtiger Teil der Chopin-Literatur war und ist auf Deutsch nicht zugänglich. Mit Maciej Golabs Buch liegt ein bedeutender Beitrag zur Chopin-Forschung, der in polnischer Sprache als Habilitationsschrift von der Universität Warschau angenommen wurde, erstmals in deutscher Übersetzung vor.
Das Buch wirft Licht auf eine für die Musikentwicklung bis in unser Jahrhundert zentrale Frage: auf die treibende Kraft der Chromatik für die Entwicklung neuzeitlicher Harmonik. Stilmerkmale der Musik Chopins werden dabei analysiert unter Berücksichtigung von Skizzen und weiteren Handschriften des Komponisten. Chopins Warschauer Studienjahre bei J. Elsner werden beleuchtet, und die Besprechung musiktheoretischer Quellen aus Polen, Deutschland und Frankreich interpretiert Chopins chromatische Harmonik im Umfeld seiner Zeit. Der Schluß, dem 'Tristan-Akkord' gewidmet, zeigt Aspekte einer Entwicklung von Beethoven über Chopin und Wagner bis hin zu Alban Berg.
Der Autor, Professor am Institut für Musikwissenschaft an der Universität Warschau, über sein Buch:
"Der ästhetische Rang der Musik Chopins war immer problematisch für eine Musikgeschichte, die (unter dem Einfluß klassischer Gattungs-Hierarchie) die Auffassung vertrat, 'musikalische Größe' ließe sich nur in den an Epos und Drama orientierten Gattungen der Sinfonie und Oper erreichen - Gattungen, die Chopin ganz außer Acht ließ. Dementsprechend sieht man in Westeuropa Chopins Platz in der Musikgeschichte häufig im Bereich 'Salonmusik', 'Virtuosität' oder 'Poetische Musik'. Die Tradition, Chopins Schaffen durch das Prisma der klassischen Gattungs-Hierarchie zu betrachten, ist auch deutschen Autoren geläufig. Man übersieht häufig, daß gerade jene Faktoren, die zur Krise der romantischen Harmonik führten und die Ernst Kurth in seiner schon klassischen Arbeit "Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners 'Tristan'" (Bern-Leipzig 1920) beschrieb, bei Chopin ungleich stärker präsent sind als bei irgendeinem seiner Zeitgenossen. Hierbei bilden weniger Fragen von Gattung und Form, als vielmehr Phänomene von Chromatik und Tonalität nicht nur einen zentralen Aspekt der Musiksprache Chopins, sondern vor allem eins der wesentlichen Probleme der Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts.
Die Arbeit ist ein Versuch, die Hauptprobleme harmonischer Analyse in der europäischen Romantik anzugehen. Einerseits wird sie sich bemühen, mit Methoden textkritischer Analyse (musikalischer Orthographie) das Notierte aufzudecken. Andererseits wird versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen der deskriptiven morphologischen und funktionalen Analyse Erpfs und modifizierten Elementen von H. Schenkers Schichtenlehre, wobei die Bedingungen vom syntaktischen Kontext geprägt werden. Außer methodologischen Problemen soll die Arbeit aber vor allem die historischen und systematischen Aspekte von Chopins Chromatik aufdecken und eine historisch-theoretisch vergleichende Perspektive aufzeigen. Chopins Chromatik wird in der spezifischen Quellenlage dar gestellt und als Träger der entwicklungsgeschichtlich dynamischsten Qualität seiner Harmonik behandelt.
Stimmen zum Buch:
Rezension von Detlef Gojowy in "Die Musikforschung" 1997, Nr. 1, S. 126-127
In verschiedener Hinsicht Neuland wird mit dieser Publikation betreten. Mit dem Bela Verlag stellt sich ein neues, hauptsächlich auf Polonica spezialisiertes Unternehmen vor. Den Autor kannte man (wenngleich kaum im deutschsprachigen Raum) als Experten für das Werk des im Krieg ermordeten Zwölftonkomponisten Jozef Koffler - hier legt der Schüler Michal Chominskis, Zofia Lissas und Anna Czekanowskas seine Habilitationsschrift vor, welche Form allenfalls wegen der ihr eigenen Weitschweifigkeit dem Leser mehr Zeit abfordert, als es kürzer gefaßte Darlegungen täten; eigentlich muß dieser eine Vorlesungsreihe absolvieren, deren Stoff allerdings Erregendes bietet.
Gemeint ist ein analytisch-systematisches Eindringen in die Strukturen der romantischen Harmonik überhaupt unter dem Blickpunkt ihrer weiteren Entwicklung in der Neuzeit, worüber sonst kaum mehr als ein paar Gemeinplätze zur Tristanharmonik im Schwange sind. Vielleicht erinnert sich dieser und jener, daß es zwischen der 'Stufenharmonik' bei Simon Sechter/Anton Bruckner und der "Funktionsharmonik" bei Hugo Riemann/Ernst Kurth Unterschiede der Betrachtungsweisen gab, doch inzwischen trifft man heute Musikwissenschaftler, die mit einem Begriff wie "reale Transposition" nichts mehr anzufangen wissen. - Erkenntnisse werden nicht nur neu erworben, sondern es gehen auch erworbene verloren. Da ist es völlig neu zu erfahren, welche Systeme der Harmonielehre zur Zeit Chopins überhaupt vorhanden und bekannt waren. Inwieweit sie ihn interessierten oder er eigenen Intentionen folgte, ist eine andere, die nächste Frage, der Golab beizukommen sucht, indem er den fundamentalen Unterschied zwischen einer "normativen" und einer "deskriptiven" Harmonielehre macht, den Unterschied also zwischen dem, was sein soll und was tatsächlich geschieht. Da geschieht schon in seiner Notation einiges vom normativen Gebrauch. Abweichende: was sind es eigentlich für "Tonarten", die er benutzt? (Und dabei dringt der Autor nicht einmal zu bestimmten, raffinierten, "synthetischen" Leitern wie der "Rimskij-Korsakov-Skala" im Themenkopf der b-moll-Sonate vor!).
Chopins Harmonik ist terra incognita, in deutschen Betrachtungen sowieso. Ludwik Bronarskis Harmonik Chopins aus den dreißiger Jahren liegt nur auf Polnisch vor und blieb deswegen unbeachtet - Golab hat zu ihr einige offenbar berechtigte Einwände, läßt aber auch einige ihrer Ergebnisse unbeachtet. Bronarski stützte sich u. a. auf Max Zulaufs grundlegende Harmonik J. S. Bachs (Bern 1927), die seitens der Bach-Forschung bisher wenig Interesse fand und als besondere Erkenntnis den Zusammenhang atonal-außertonaler Strukturen mit einer besonders konsequenten Quintfall-Harmonik feststellte, wie sie auch bei Chopin eine bedeutende Rolle spielt. Leider geht Golab an diesen Erkenntnissen wie auch an Zulauf überhaupt vorbei, obschon Bachs Einfluß auf Chopin von Anfang an, dank dem Unterricht Josef Elsners, nicht gering war.
Was man Golabs Buch verdankt, bleibt gleichwohl neben dem kühnen Vorstoß in eine "deskriptive" Harmoniebetrachtung die Einsicht in grundlegende Strukturen der Chopinschen Harmonik, die von herkömmlichen tonalen Modellen abweichen, und in diesem Zusammenhang sogar der Ansatz zu einer Periodisierung seiner Sprache. Es verbleibt ferner die Einsicht in eine Fülle ungelöster Probleme, die die Harmonik des 19. Jahrhunderts stellt, wenn wir überhaupt von ihr wissen wollen. (Rezension von Detlef Gojowy in "Die Musikforschung" 1997, Heft. 1, S. 126-127)
Maciej Golab, Jahrgang 1952, studierte Musikwissenschaft an der Warschauer Universität bei Jozef Michal Chominski, Zofia Lissa und Anna Czekanowska. 1978-1980 Assistent, seit 1981 Adjunkt am Musikwissenschaftlichen Institut Warschau. 1981 Promotion, 1990 Habilitation, seit 1994 Professor am Institut für Musikwissenschaft der Warschauer Universität, auch Professor an der Universität Breslau, 1991-1996 Vizedirektor des Instituts für Musikwissenschaft der Warschauer Universität.
Prof. Golabs Forschungsschwerpunkt liegt in der Musik des 19. und 20. Jahrhunderts. Neben zahlreichen Artikeln verfaßte M. Golab Bücher über Dodekaphonik (Dodekafonia, Bydgoszcz 1987), über Chopins Harmonik (Chromatyka i tonalnosc w muzyce Chopina, Krakow 1991; deutsch als: Chopins Harmonik. Chromatik in ihrer Beziehung zur Tonalität, Köln 1995), sowie eine Monographie über den Komponisten Jozef Koffler (Jozef Koffler, Krakow 1995).
 |
Detlef Gojowy
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
Mit der vorliegenden Monographie über Augustyn Bloch soll nicht
allein ein wichtiger Komponist der Neuen Musik porträtiert werden.
Es soll auch ein Einblick in die Kultur und Geschichte unseres Nachbarlandes,
seines Heimatlandes eröffnet werden: von Polen, dessen wichtiges Festival
der musikalischen Avantgarde, den "Warschauer Herbst", Augustyn Bloch jahrelang
betreut hat. Der "Warschauer Herbst" bildet ein zentrales Kapitel der europäischen
Musikgeschichte im 20. Jahrhundert. Augustyn Bloch ist davon Zeitzeuge
und daran Beteiligter.
Stimmen zum Buch:
Rezension von Eberhard Kneipel in: "Das Orchester" 2000, Nr. 6, S.
72-73
Wie Krzysztof Meyer - dem im gleichen Verlag eine Veröffentlichung
zuteil wurde - zählt Augustyn Bloch zu den weniger spektakulär
in Erscheinung getretenen polnischen Komponisten. Im Ausland ist er spätestens
seit dem zum Beethovenjahr 1970 geschriebenen und in der Beethovenhalle
Bonn uraufgeführten, preisgekrönten Orchesterwerk Enfiando
sowie durch Auftritte der ,,polnischen Nachtigall", der virtuosen Sopranistin
Halina Lukomska, bekannt geworden. Für sie, die Ehefrau, hat er Stücke
wie Espressioni per soprano ed orchestra und Meditationen
für Sopran, Orgel und Schlagzeug komponiert, in denen sich seine Welt
sensibler Klänge und bildhafter Inspirationen - der Umgang mit Reihentechnik
und Mikro-Intervallen, der Bezug auf Bibelwort und Kirchenmusik, der Hang
zu Orgel und Oratorium - auftut. Ein aufgeschlossener, undogmatischer Umgang
mit
Tradition und Moderne, der Blochs schöpferisches Naturell bestimmt,
prädestinierte ihn zudem dafür, auch auf dem Feld der Musikorganisation
souverän und fruchtbar zu wirken. In der Programm-Kommission des durch
Weltoffenheit und avantgardistisches Engagement im ,,Ostblock" einzigartigen,
seit 1956 geradezu legendär gewordenen Musikfestivals ,,Warschauer
Herbst" erwarb er sich ebenso Verdienste wie als Vizepräsident des
polnischen Komponistenverbandes.
Im Gespräch mit Herausgeber Detlef Gojowy tritt der 1929 geborene
Bloch als munterer Plauderer auf. Einen Scherzbuben nennt er sich selbst,
doch was er locker und anekdotisch an Rückblicken und Gegenwartsbetrachtungen
über die Darmstädter Ferienkurse und das Warschauer Festival,
über Kriegs- und Nachkriegszeiten, über zuckliegende (kultur-)
politische Repressalien und über die neue Diktatur von Zeitgeist und
Business zu berichten weiß, trägt Züge des schwejkschen
Humors: Schlauheit und Witz als eine Art von Weltanschauung und Lebensbewältigung.
Das wissenschaftlich-sachliche ,,Gegengewicht" zum assoziationsreich-informativen
Dialog schaffen Mieczyslaw Kominek, Detlef Gojowy und Lutz Lesle mit Kommentaren
zu geistlichen Schlüsselwerken und Martina Homma mit ihrem lexikalischen
Text. Dieser liefert nicht nur wichtige Angaben zur Biografie von Augustyn
Bloch und grundlegende Erkenntnisse zu dessen kompositorischem Handwerk,
sondern er legt auch ein komplettes Werkverzeichnis (bis 1998) vor, das
neben einer Diskografie die Erläuterungen des Komponisten zu seinen
Stücken enthält.
Insgesamt liegt mit dieser Veröffentlichung ein vielseitig-informatives
Künstler-Porträt vor -und überdies eine aufschlussreiche
Betrachtung zur Geschichte und Kultur Polens. Wie schon bei Meyer, so wird
auch bei Bloch deutlich, dass unser Nachbarland dem zeitgenössischen
Musikschaffen mehr als bloß eine Handvoll Namen von Belang beizusteuern
hat.
(Rezension von Eberhard Kneipel in: "Das Orchester" 2000, Nr. 6, S.
72-73)
Augustyn Bloch, Jahrgang 1929, studierte
an der Warschauer Musikhochschule Komposition und Orgel (bei Feliks Raczkowski
und Tadeusz Szeligowski). Seit früher Jugend wirkt er als Organist
und hat zahlreiche Werke für das Theater des Polnischen Rundfunks
geschrieben. Er war Vicevorsitzender des ZAIKS (eines Verbandes, der in
Polen der GEMA vergleichbare Aufgaben wahrnimmt) und betätigte sich
viele Jahre ehrenamtlich in der Programmkommission des "Warschauer Herbstes",
1979-1987 als deren Vorsitzender. 1977-79 sowie 1983-87 war er Vicevorsitzender
des Polnischen Komponistenverbandes ZKP. Seine Werke wurden vielfach international
ausgezeichnet, beispielsweise die "Dialoghi per violine e orchestra" mit
einem Preis der UNESCO. Mit Konzerten und Vorlesungen trat Augustyn Bloch
in zahlreichen Ländern hervor. Jüngere großangelegte Werke
sind inspiriert von Gemäldezyklen, und in Blochs geistlichen Werken
klingen Traditionen verschiedener Liturgien an: Reminiszenzen des gregorianischen,
byzantinischen und synagogalen Gesangs sowie des protestantischen Chorals.
Detlef Gojowy, Jahrgang 1934, hat sich als Musikwissenschäftler und langjähriger Redakteur beim Westdeutschen Rundfunk in ungezählten Rundfunkbeiträgen und gewichtigen Publikationen stark für die neue Musik aus Länder des ehemaligen Ostblocks eingesetzt. Er ist als Autor zahlreicher Bücher hervorgetreten und hat die neuere Musikentwicklung in Polen über Jahrzehnte hindurch intensiv und engagiert verfolgt.
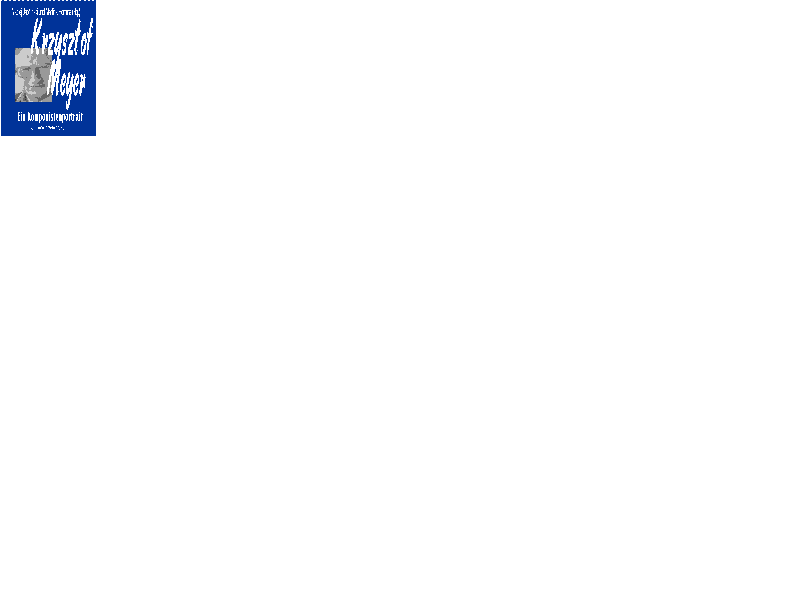 |
Maciej Jablonski und Martina Homma (Hg.)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Meyer, Jahrgang 1943 in Krakau
geboren und seit 1987 Professor für Komposition an der Musikhochschule
Köln, ist durch sein langjähriges Wirken in der Kommission des
Warschauer-Herbst-Festivals, in Jurys internationaler Kompositionswettbewerbe
und durch seine pädagogische Arbeit wohl vertraut mit der Musik unserer
Zeit in Ost und West. Im vorliegenden Band spricht er über aktuelle
Themen des gegenwärtigen Musiklebens; Aufsätze von deutschen,
polnischen und russischen Autoren beleuchten Meyers Kompositionen, und
der Anhang dokumentiert seine Arbeit.
Stimmen zum Buch:
Rezension von Eberhard Kneipel in: "Das Orchester" 1999, Nr. 11, S. 73
Das Buch gibt Kunde von einem Einzelgänger, der im komplizierten Wegesystem, der Neuen Musik scheinbar in Randbezirke gelangt ist. Dorthin wo die Wogen und Auseinandersetzungen um ihre Normen und Standards nur noch von Ferne nachklingen. Er hat alle Zentren besichtigt und ist vielen Moden gefolgt - jetzt aber beansprucht er seinen eigenen Standort. Als Unzeitgemäßer zeigt sich also der polnische Komponist Krzysztof Meyer; als Mann des Ausgleichs liefert er der heutigen Musik die beachtenswerte Facette - in seinem Heimatland ebenso wie in Europa. Die Avantgarde mit ihrer Komplizierung von Idee und Handwerk gilt ihm wenig und die Simplifizierungen und der Eklektizismus der Postmoderne bleiben ihm suspekt. Bach, Beethoven und Brahms, Schostakowitsch, Messiaen und Bartok, Webern, Ligeti und Lutoslawski sind es, die seine Entwicklung und seine Musik bestimmen - nicht deren Klang, wohl aber die Haltung und Ästhetik ihrer Produktion. Da wundern sechs Sinfonien, zehn Streichquartette, Bühnenwerke, Kammermusik, geistliche Stücke in seinem Werkverzeichnis kaum!
Dessen 80 Titel, die Liste seiner theoretischen Arbeiten, eine Bibliografie und Diskografie sowie der biografische Abriss bieten unerlässliche Sachinformationen. Und die Gespräche, die Maciej Jablonski mit Meyer führte, der 1943 in Krakau geboren wurde und mit 18 Jahren als Komponist debütierte, der ab 1966 mit zahlreichen Preisen bedacht und auf allen internationalen Musikfestivals gespielt wurde und der seit1 987 als Professor in Köln wirkt, geben Aufschlüsse über das Schaffen, über die Musik der Gegenwart, über psychologische und philosophische Aspekte der musikalischen Zeit und des Hörens, über Musikerziehung und Musikkultur. Und über die eigene Person. Dieser Dialog überzeugt durch analytische Präzision, geistige Aufgeschlossenheit und eigenständiges Denken. Und sein Verlauf entspricht dem Gehalt und der Form von Meyers Komponieren - indem wichtige prägnante Kerngedanken exponiert und zielstrebig entwickelt werden.
Meyer bekennt sich zum Hörer als Subjekt des Rezeptionsprozesses. Vielfältige und kontrastreiche Relationen innerhalb der Werkgestalt sind ihm Voraussetzung, damit ein Werk keine bloße Reihung von Klangreizen bleibt, sondern als logische Folge strikt musikalischer Ereignisse existiert - und eine spezifische Semantik hervorbringen kann. Den Nachweis eines solchen Denkens in Tönen führt der zweite Teil des Buchs deshalb so überzeugend und anregend, weil die Autorinnen und Autoren bestens mit Meyers Schaffens vertraut und in der Lage sind, dessen Originalität zu beschreiben und zu bewerten. Lutz Lesle untersucht die Konzeption sowie Fragen von Form und Stil in der Instrumentalmusik anhand ausgewählter Konzerte. Irina Nikolska zeichnet die Entwicklung des Sinfonikers nach und Wolfgang Osthoff analysiert die Beziehung von Kunst und Bekenntis anhand der Polnischen Sinfonie. Bohdan Pociej kennzeichnet wesentliche Aspekte der Kammermusik, und Martina Homma vertieft die Sicht auf Kompositionstechnik und Gattungstradition mit Blick auf die Streichquartette.
Entstanden ist das Porträt eines Komponisten, der bislang womöglich eher als Verfasser einer Schostakowitsch-Biografie bekannt war (sein Buch über Lutoslawski liegt leider noch nicht in deutscher Sprache vor), und das nun dessen künstlerisches Format eindrucksvoll ins rechte Licht setzt. Es zeigt einen Mann, für den Unabhängigkeit kraft der eigenen Persönlichkeit am allerwichtigsten ist und der sich danach sehnt, "etwas Dauerhaftes in der Kunst" hervorzubringen. (Rezension von Eberhard Kneipel in: "Das Orchester" 1999, Nr. 11, S. 73)
UNBERÜHRT VOM ZWANG ZUM AVANTGARDISMUS
Der in Polen geborene und aufgewachsene, aber heute in Köln lebende
Krzysztof Meyer erhält mit diesem Buch ein Forum, wo er im Gespräch
seine Ideen zur Musikerziehung, zur Kompositionstechnik und über sich
selbst exponieren kann. Es entsteht damit das Bild eines Künstlers,
der pädagogisch engagiert und leicht verständlich seine Grundsätze
darlegt, die vollkommen unberührt vom Zwang zum Avantgardismus sind.
Eine Auseinandersetzung mit Theodor W. Adorno, die vielen im Westen schaffenden
Komponisten de rigueur scheint, fehlt vollkommen. Meyer bleibt offen
für vielerlei Einflüsse, ohne sich eng einer bestimmten Richtung
anzuschliessen. Da er bei Nadia Boulanger studiert hat, verfügt er
über ein sicheres Metier, das frisch und spontan bleibt, ohne in rein
handwerkliches Banausentum abzufinden. Es sei die Aufgabe des Komponisten,
Musik zu schaffen. und nicht darüber zu sprechen, bemerkt er im Gespräch;
er misstraut allen programmatischen Erklärungen und versucht, «ein
Unabhängigkeitsempfinden zu stärken«, da er als Komponist
«fast immer ein Outsider« gewesen sei. Fern ist ihm aber trotzdem
die weinerliche Attitüde eines sich unverstanden Fühlenden, obwohl
er mit der gegenwärtigen Lage der Musik im Allgemeinen nicht zufrieden
ist. «Nicht die Sehnsucht nach einem weiteren Schock oder einem Gänsehaut
hervorrufenden Effekt« sucht er, sondern «ein neues, tieferes
Erleben«. Dabei orientiert er sich formal an Beethoven und Brahms,
bleibt aber offen für Webern, Messiaen, Boulez und neuere Komponisten
wie Ligeti und Kagel, ohne Lutoslawski zu vergessen, seinen Landsmann,
auf den er immer wieder zurückkommt. - Texte von Lutz Lesle, Irina
Nikolska, Wolfgang Osthoff und anderen ergänzen den Band, der auch,
höchst hilfreich, ein Werkverzeichnis, eine Diskographie und eine
Bibliographie enthält, nebst dem unentbehrlichen Register.
(hbr) in: Dissonanz, März 2000
Maciej Jablonski, Jahrgang 1962, Musikwissenschaftler und -kritiker, lehrt an der Universität Poznan und beschäftigt sich mit der Geschichte der Oper, mit Musikästhetik und -semiotik. Seine Publikationen in diesem Bereich erschienen u.a. in Bloomington, Helsinki, Cremona und Brno.
Martina Homma begann ihre Hochschulausbildung bereits parallel zum Schulbesuch (nach ersten Preisen bei "Jugend musiziert") und studierte Klavier und Cello an der Folkwang-Hochschule. Fortsetzung des Studiums in Köln - wiederum parallel an Musikhochschule (Klavier, Schulmusik, Tonsatz) und Universität (Musikwissenschaft, Germanistik, Philosophie, Slavistik). Studienbegleitende Tätigkeit als Kirchenmusikerin sowie als Lehrerin an einer Musikschule, Studienabschlüsse 1984, 1985, 1986 jeweils "sehr gut". Aufsätze, Rezensionen, Rundfunksendungen und Beiträge für Fachlexika zur Musik des 19. und 20. Jahrhunderts. Dissertation "opus eximium" über Witold Lutoslawski. Lehrerfahrung an Musikhochschule (Musiktheorie, Kontrapunkt, Partiturkunde, Formenlehre) und Universität Köln sowie als Gastprofessorin an der Universität Siegen (Musikwissenschaft). Gastvorträge und Symposia im In- und Ausland. 1996 Wahl in den Vorstand der Kölner Gesellschaft für Neue Musik. Ehrenamtliche Tätigkeit in mehreren musikalischen Gremien.